Roboter in einem Operationssaal – das klingt erst mal futuristisch. Doch worauf kommt es wirklich an, damit sie Ärzt:innen und Patient:innen einen echten Vorteil bringen? Prof. Dr. Bernhard Meyer, Direktor der Neurochirurgie an der TU München, und Nils Ehrke, President EMEA bei Brainlab, erklären, warum Robotik im OP kein Selbstzweck ist, welchen Mehrwert sie dennoch bieten kann – und was High Performance Chirurgie mit Profisport zu tun hat.
Herr Professor Meyer, wie viel Robotik steckt denn heute schon wirklich im OP-Alltag – und wie viel Hype?
Prof. Bernhard Meyer: Man muss unterscheiden. Robotik klingt erstmal nach Zukunftsmusik, nach Maschinen, die selbstständig operieren. Davon sind wir aber viele Jahre entfernt. Was heute unter Robotik im OP verstanden wird, ist meist eine Form der halbautomatisierten Navigation. Das sind also eher Assistenzsysteme, die im chirurgischen Arbeitsablauf unterstützen können – das ist schon mal nicht schlecht, aber es ist natürlich noch kein operierender Roboter.
Was erwarten Sie denn generell von Technik im OP?
Prof. Bernhard Meyer: Mein Ziel ist simpel: Ich will operieren. Und zwar effizient, sicher und ohne Ablenkung. Alles drum herum – Navigation, Bildgebung, Vorbereitung – muss mich dabei unterstützen, nicht aufhalten. Deshalb müssen neue Technologien nicht nur besser sein, sondern auch schneller oder zumindest gleich schnell wie die alten Methoden. Sonst setzen wir sie nicht ein. Ich möchte nicht durch Technik gebremst werden. Und: Ich will denken können. Technik soll mir Raum geben, nicht ihn nehmen.

Prof. Bernhard Meyer war unter anderem Präsident der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft (DWG) und der Deutschen Akademie für Neurochirurgie sowie Vorstandsmitglied vieler internationaler neurochirurgischer und wirbelsäulenchirurgischer Organisationen. Er leitet seit 2006 die Klinik für Neurochirurgie am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München – einer der renommiertesten neurochirurgischen Einrichtungen Europas.
Er gilt als einer der führenden Experten für Wirbelsäulen- und Schädelbasischirurgie, hat zahlreiche internationale Fachgesellschaften mitgeprägt und sich einen Ruf als pragmatischer Innovationstreiber erworben.
Herr Ehrke, Prof. Meyer sprach gerade davon, dass Robotik den chirurgischen Arbeitsablauf unterstützen kann – was heißt das genau?
Nils Ehrke: Das ist zum Beispiel ein robotisch gesteuerter Arm, der eine geplante Position millimetergenau ansteuert und anschließend eine präzise Führung der OP-Instrumente ermöglicht. Damit wollen wir Chirurginnen und Chirurgen gezielt unterstützen – allerdings funktioniert das nur, wenn Robotik als Teil eines durchdachten Gesamtablaufs verstanden wird. Sie entfaltet ihren Nutzen erst in Kombination mit der Navigation, die dem Roboter sagt, wo er überhaupt hinmuss.
Robotik und Navigation bilden dabei eine technische Einheit – aber diese kann ihre volle Stärke nur dann ausspielen, wenn sie eingebettet ist in einen auf den jeweiligen Patienten abgestimmten chirurgischen Workflow. Die Anatomie, die Planung, die Abläufe im OP: All das muss zusammenpassen.
Viele Kliniken investieren in Robotik, um besonders innovativ zu wirken. Aber wenn der klinische Workflow nicht als integrativer Bestandteil aus Technik und medizinischer Behandlung verstanden wird, hilft auch der beste Roboter nichts. Unsere Erfahrung zeigt: Der volle Nutzen entsteht nur durch das Zusammenspiel aus präziser Bildgebung, sorgfältiger Planung, chirurgischer Navigation – und einem klinischen Workflow, der auf diese Technik abgestimmt ist. Robotik kann diesen Ablauf sinnvoll erweitern – sie darf aber nie der Ausgangspunkt sein.
Und was ist nun der optimale Workflow – und inwiefern hat er so einen starken Einfluss auf den Erfolg der Robotik?
Prof. Bernhard Meyer: Um das zu verstehen, muss man sich zunächst klarmachen, wie ein Navigationssystem überhaupt funktioniert: Es gleicht das Planungsbild – etwa ein CT – mit dem realen Patienten ab, der vor einem liegt. Sobald diese Registrierung abgeschlossen ist, darf sich der Patient – insbesondere die Wirbelsäule – nicht mehr bewegen.
Früher haben wir beim Schraubensetzen mit sogenannten Aalen gearbeitet – starren Führungsnadeln, bei denen man viel Druck auf die Wirbelsäule ausüben musste. Das konnte zu einer leichten Bewegung der Wirbelsäule führen; damit verliert die Navigation – und natürlich auch die Robotik – ihre Präzision.
Deshalb haben wir unseren Workflow im OP angepasst. Heute bohren wir mit einem hochdrehenden Bohrer vor – den kann man sich ein bisschen wie einen Akkuschrauber aus dem Baumarkt vorstellen. Der arbeitet nahezu druckfrei, wodurch keine Verwindung der Wirbelsäule entsteht. In dieses Bohrloch führen wir anschließend einen dünnen Draht ein, den sogenannten Kirschner-Draht. Der dient uns dann als Führung, um die Schraube exakt entlang der geplanten Bahn einzusetzen.
Das reduziert Fehlerquellen. Und ich habe am Ende eine Arbeitsweise, die mir Zeit spart und gleichzeitig die Präzision erhöht.
Nils Ehrke: Ich habe diesen Workflow tatsächlich zum ersten Mal hier in der Klinik von Prof. Meyer im Detail erlebt – und sofort erkannt, dass wir ihn unseren Kunden empfehlen sollten, noch bevor diese überhaupt über die Anschaffung eines Roboters nachdenken. Das Verständnis der Prinzipien chirurgischer Navigation – sowie ein darauf abgestimmter, optimierter chirurgischer Workflow – bilden die Grundlage für den Einsatz von Robotik. Erst wenn diese Komponenten perfekt ineinandergreifen, kann die Robotik ihr volles Potenzial entfalten – zum Vorteil sowohl der Behandelnden als auch der Patientinnen und Patienten.
Man kann das vielleicht mit dem Konzept der „Marginal Gains“ aus dem Profisport vergleichen: Viele kleine Verbesserungen – sei es bei der Bildgebung, der Planung, der Registrierung oder dem klinischen Workflow – ergeben in Summe einen deutlichen Qualitätsgewinn. Robotik ist dann nicht die Lösung an sich, sondern Teil eines Systems, das in seiner Gesamtheit besser wird.
Inwiefern profitieren denn die Patientinnen und Patienten?
Prof. Bernhard Meyer: Zunächst mal können wir heute Menschen operieren, die vor 15 Jahren noch als „nicht operabel“ galten – 80 Jahre und älter. Weil wir wissen: Wenn wir es richtig machen, geben wir ihnen viel Lebensqualität zurück und sie profitieren massiv. Wir verschieben ständig die Grenze dessen, was möglich ist – mit Augenmaß.
Darum ist heute selbstverständlich, dass man eine Navigation verwendet, wenn man an der Wirbelsäule operiert. Vor 15 Jahren war das noch exotisch. Heute setzen wir Schrauben navigiert, schnell, sicher, minimalinvasiv.
Dass wir eine Arbeitsweise etabliert haben, die uns Zeit spart, kommt übrigens auch den Patienten zugute. Erstens können wir mehr Menschen operieren, zweitens kommt es bei den vielen älteren Patienten auch auf jede Minute an, die wir ihnen in Narkose ersparen können.
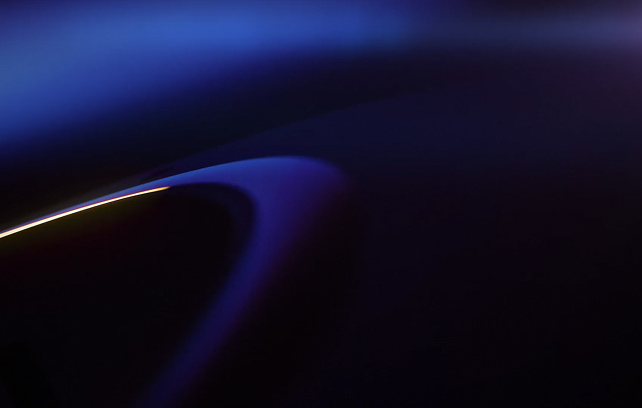
Erleben Sie neue chirurgische Möglichkeiten mit Loop-X
Haben Sie als sehr renommierter Neurochirurg, der Sie ja zweifelsfrei sind, eigentlich manchmal Sorge, dass Navigation und Robotik künftig Operationen so einfach machen, dass auf einmal jeder operieren kann, was bisher nur Sie konnten?
Prof. Bernhard Meyer (lacht): Das muss doch immer das Ziel sein, dass heute meine Kolleginnen und Kollegen Sachen operieren können, wo man vor ein paar Jahren noch irgendeine Koryphäe gebraucht hätte. So etwas nennt man Fortschritt.
Übrigens glaube ich nicht, dass der Alltag von wirklich guten Chirurgen durch diese Technologien einfacher wird – im Gegenteil. Wer besonders erfahren ist, übernimmt zunehmend die komplexeren Fälle. Damit steigen nicht nur die Anforderungen an die Behandlung, sondern auch an die Technik. Denn je besser wir werden, desto mehr verschieben wir die Grenzen dessen, was möglich ist – Schritt für Schritt. Die Verantwortung wächst mit der Expertise. Und am Ende zählt dann doch wieder: Erfahrung, Urteilskraft – und die Fähigkeit, unter Druck die richtige Entscheidung zu treffen.
Gibt es so eigentlich so etwas wie eine Grundhaltung, die man als guter Chirurg mitbringen muss?
Prof. Bernhard Meyer: Ja. Man darf nicht zaudern. Im OP entscheidet man ständig – manchmal jede Sekunde. Wenn man ins Grübeln kommt, ist es zu spät. Ein Operateur muss fokussiert sein, entschlossen, aber auch ehrlich mit sich selbst. Ich bin kein Freund von überhöhten Ego-Nummern im OP. Es geht nicht um den einen „Star-Chirurgen“, sondern um reproduzierbare Qualität. Die Frage ist: Kann man andere dazu bringen, genauso gute Entscheidungen zu treffen wie man selbst? Das ist für mich echte Exzellenz.


Zurück zur Robotik: Was empfehlen Sie Kliniken, die über eine entsprechende Investition nachdenken?
Nils Ehrke: Erst den Workflow optimieren: Navigation, Bildgebung, OP-Abläufe. Und wenn das alles sitzt – dann kann ein Roboter das Ganze ergänzen. Aber nicht umgekehrt. Wer zuerst den Roboter kauft und dann versucht, den Rest drum herum zu bauen, wird sich schwerer tun, das Optimum aus so einer Investition herauszuholen.
Prof. Bernhard Meyer: Das sehe ich auch so. Ich bin immer für Innovation. Aber ich bin auch für ehrliche Technik und für realistische Versprechen. Ich finde Robotik total spannend – aber wenn jemand so tut, als sei damit alles besser, dann werde ich skeptisch.
Ein guter klinischer Workflow ohne Roboter bringt mehr als ein Roboter ohne optimalen klinischen Workflow.
"Wir müssen wachsam bleiben. Technik darf nie Selbstzweck sein. Sie muss das Team stärken, nicht ersetzten."
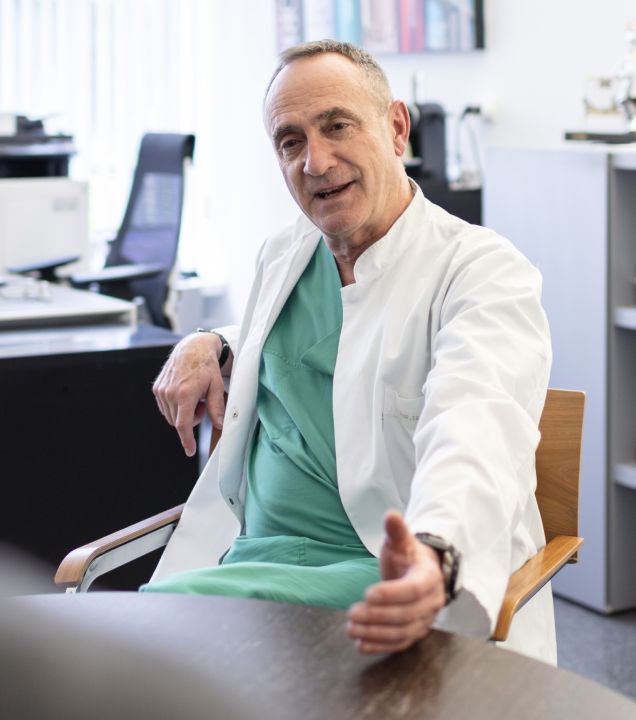
Zum Schluss ein Blick nach vorn: Wie sehen Sie die Zukunft der chirurgischen Robotik?
Prof. Bernhard Meyer: Ich denke, in fünf bis zehn Jahren werden wir erste Systeme sehen, die tatsächlich autonome oder zumindest teilautonome Funktionen übernehmen können – vor allem, wenn Sensorik und KI richtig integriert sind. Der Schlüssel liegt in der Haptik: Roboter, die fühlen können, wann sie durch Knochen oder weiches Gewebe arbeiten, werden vieles verändern. Aber: Wir müssen wachsam bleiben. Technik darf nie Selbstzweck sein. Sie muss das Team stärken, nicht ersetzen.



